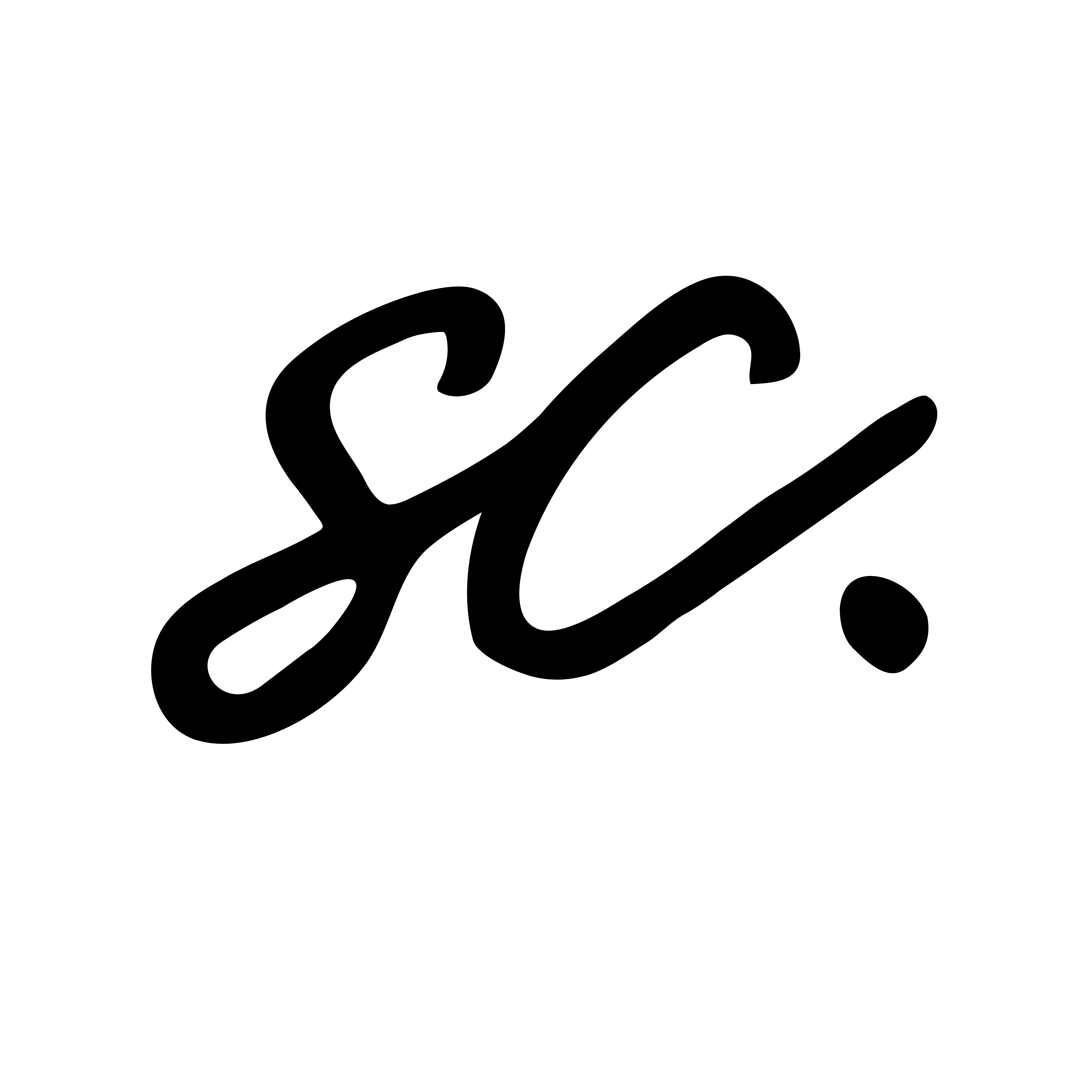Die Jahreslosung 2025 kommt aus dem 1. Thessalonicherbrief 5,21:
«Prüft alles und behaltet das Gute!» oder, wie man auch übersetzten könnte (nach Schlatter): «Erprobt aber alles; das Gute haltet fest».
Das bedeutet zum einen – ganz einfach – dass nicht alles gut sein wird, was uns in diesem Jahr begegnen und zu Ohren kommt. Das ist soweit wenig überraschend. Es bedeutet aber auch, dass nicht alles schlecht sein wird, was wir im ersten Moment als schlecht zu erkennen meinen. Viel eher geht es darum, alles zu prüfen bzw. zu erproben.
Paulus wirkt hier nüchtern, realistisch und abgeklärt; bevor wir ein Drama veranstalten, weil wir etwas vorschnell als schlecht/falsch einstufen – oder der faszinierten Aufregung verfallen, weil wir etwas als überaus gut/richtig zu erkennen meinen –, sollten wir erst einmal nüchtern prüfen, was uns begegnet und zu Ohren kommt.
Im Kontext der Prophetie
Paulus schreibt diesen Vers im Kontext von Gemeinde, dem Geisteswirken und Prophetie – also da, wo in der Gemeinde im Namen Gottes gesprochen wird. Weil Jesus das Haupt der Gemeinde ist, ist sie unter der Einwirkung des Heiligen Geistes – daher wird in ihr (in welcher Form auch immer) Prophetisches zu Tage treten. Schlatter[1] schreibt dazu: «Sie [die Gemeinde] schätzt sie [die Prophetie] zu wenig, wenn sie auf die inneren Bewegungen, die aus dem Geist stammen, nicht achtet, ihnen Mißtrauen entgegenbringt und den Gehorsam verweigert.» Klar ist, dass der Geist nicht anders kann, als durch (unvollkommene) Menschen zu wirken. Daher gilt eben auch: «Aber auch dann schätzt die Gemeinde die inwendigen Bewegungen, die im Geist ihren Ursprung haben, nicht richtig, wenn sie sich dem, was ihr im Namen des Geistes gesagt wird, blind unterwirft.» Denn Jesus gibt niemandem die Herrschaft über die Gemeinde. Alles soll geprüft werden.
Die Notwendigkeit zu Prüfen
Schlatter (und Paulus) schlägt da einen herrschafts- und autoritäts-kritischen Ton an. Sich einzugestehen, dass niemand (auch keine Prophetin und kein Prophet) darüber erhaben ist, dass alles geprüft werden soll, hat einen anti-autoritären Charakter. Denn klar ist: Niemand ist neutral. Wir alle leben von Voraussetzungen und Neigungen, denen wir uns nicht umfassend bewusst sind. Niemand geht neutral an einen Text oder an ein Thema heran – auch der Heilige Geist ist da kein «Wundermittel». Wenn er das wäre, müssten wir ja nicht prüfen, denn (1) gäbe es – zumindest in der Gemeinde – nichts zu prüfen, weil dann das «reine Wort Gottes» prophezeit würde und (2) wüssten wir immer ganz klar und schnell, was richtig und falsch ist – auch dann müssten wir nicht mehr prüfen. Stattdessen müssen wir uns immer wieder die Frage gefallen lassen: «Welche Interessen, Triebe, Beweggründe treiben mich, wenn ich mich dem Text [oder dem Thema, oder ganz grundsätzlich: Gott] nähere? Sind sie womöglich so stark, dass sie geeignet sind, dem Text [oder dem Thema, oder ganz grundsätzlich: Gott] Gewalt anzutun? Kann ich anders, als dass er sagen muss, was ich will?», so Hempelmann[2].
Genau darum ruft der Apostel die Gemeinde in Thessaloniki auf alles (!) zu prüfen. Wie Schlatter sagt: Nicht in grundsätzlichem Misstrauen, aber eben auch nicht in naivem, blindem Vertrauen.
Ein Plädoyer für hörende Herzen
Paulus ruft die Gemeinde auf, alles zu prüfen, und er tut das im Plural. Also nicht jeder für sich, sondern miteinander.[3] Informationen, Aussagen, Prophetien und Meinungen zu prüfen, braucht Zeit. Zeit, die wir uns heute kaum mehr nehmen. Alles sollte zack-zack, hopp-hopp und schnell-schnell gehen. Um zu prüfen, brauchen wir aber Zeit und in zweifacher Weise ein hörendes Herz. Zum einen gegenüber unseren Mitmenschen: Verstehen wir wirklich, was sie uns (im Namen Gottes) sagen wollen? Und zum anderen gegenüber Gott: Was denkt er dazu?
Den Aufruf von Paulus «Prüft alles, das Gute behaltet!» verstehe ich auch als Plädoyer für einen geerdeten, der Polarisierung entgegenwirkenden Umgang mit Aussagen, die an uns herangetragen werden. Paulus wirbt für weniger Aufschrei, dafür für mehr hörende Herzen; Herzen die dem Gegenüber und Gott zuhören, weil sie wissen, dass sie noch viel zu lernen haben und ihr Erkennen Stückwerk ist und bleibt:
«Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich erkannt bin.» 1. Korinther 13,12 (LUT)
«Die Wendung ‘mit Hilfe eines Spiegels’ will sagen, dass wir nur das Spiegelbild sehen, nicht die Sache selbst, d.h. dass wir nur mittelbar und indirekt sehen, nicht unmittelbar und direkt.», so Schnabel[4]. Es ist eben nicht so, dass jemand unmittelbar, unvermittelt, in einem direkten Zugriff auf das Wahre und die Wahrheit lebt. Wir alle Schauen durch einen Spiegel und sehen indirekt. Wir alle interpretieren. Unsere Prägungen, Voraussetzungen, Triebe, Interessen, Vorlieben und, und, und… prägen uns mehr, als wir denken. Unsere Meinungen und Urteile sind immer vor-letzte Meinungen und Urteile[5] – das letzte Wort hat «dann aber» Gott, wenn er das Vollkommene bringt. Erst wenn «dann aber» Gott «von Angesicht zu Angesicht» erscheint, ist der Moment da, wo nicht mehr geprüft werden muss. Es wird «dann aber» ziemlich sicher so sein, dass wir nochmals überrascht sein werden – also unser Erkennen als Stückwerk und unsere Urteile als vor-letzte Urteile uns bewusst werden.
Wir brauchen Herzen, die danach suchen, das Gute auch da zu behalten, wo es uns – aus welchen Gründen auch immer – im ersten Moment triggert. Paulus wirb dafür, das Kind nicht mit dem Bad auszuschütten und auch da das Gold zu suchen, wo es von viel Dreck umgeben ist – bzw. auch immer wieder daran zu denken, dass nicht alles Gold ist, was glänzt.
Ich wünsche mir ein demütiges, hörendes Herz, das sich nach dem Prüfen aber doch dafür hat, das Gute gut zu nennen und das Schlechte schlecht zu nennen – das aber in aller Bescheidenheit, weil unser Erkennen Stückwerk ist und bleibt (vgl. 1. Kor 13,12) und wir wissen, dass unsere Urteile immer vor-letzte Urteile bleiben.
Literatur
[1] Adolf Schlatter, Die Briefe an die Thessalonicher, Philipper, Timotheus und Titus: Ausgelegt für Bibelleser, Zweite Auflage., Bd. 8, Schlatters Erläuterungen zum Neuen Testament (Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1954), 33–34.
[2] Hempelmann, Heinzpeter 2008. „Wir haben den Horizont weggewischt“: Die Herausforderung: Postmoderner Wahrheitsverlust und christliches Wahrheitszeugnis. Witten: SCM, Brockhaus. S. 257f
[3] Albert L. Lukaszewski, Mark Dubis, und J. Ted Blakley, The Lexham Syntactic Greek New Testament, SBL Edition: Expansions and Annotations (Bellingham, WA: Lexham Press, 2011), 1. Thess 5,21.))
[4] Schnabel, Eckhard J. 2018. Der erste Brief des Paulus an die Korinther. 4. Auflage. Witten: SCM R.Brockhaus. S. 779
[5] Hempelmann, Heinzpeter 2008. „Was sind denn diese Kirchen noch …?“: Christlicher Wahrheitsanspruch vor den Provokationen der Postmoderne. 2. Aufl. Wuppertal: SCM, Brockhaus. S. 251